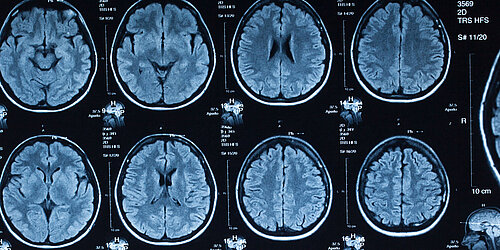Copyright: adobe stock / merydolla
Das KI-Leuchtturmprojekt KI-INSPIRE entwickelt KI-basierte Verfahren, die die Strahlendosis in der medizinischen Bildgebung reduzieren sollen. Projektkoordinator Prof. Christoph Hoeschen, Universität Magdeburg, berichtete uns über die Methoden.
Herr Hoeschen, welchen Mehrwert bietet die Idee von KI-INSPIRE für die Medizin?
Hoeschen: Strahlenbasierte Verfahren wie etwa die Computertomographie sind in der Diagnostik und der minimalinvasiven Therapie wichtig, um ein Bild von medizinischen Gegebenheiten zu erhalten und Patient*innen passend zu behandeln. Allerdings ist damit auch eine Strahlenexposition verbunden, für Patient*innen ebenso wie für das medizinische Personal. Unser Verfahren in KI-INSPIRE kann so die potenziell schädliche Strahlendosis maßgeblich reduzieren. Das ist für mich genau der richtige Bereich, um KI anzuwenden: Dort, wo es Menschen direkt hilft.
Wie geschieht das konkret?
Wir verbessen die Bildqualität bei gleichzeitig weniger verwendeten Rohdaten. Bei der Intervention werden immer wieder die gleichen Bereiche im Bild aufgenommen, zeitgleich wird eine Nadel oder ein Katheter eingeführt. Das bedeutet: Sie haben ganz viele Vorabinformationen. Und diese Informationen kann ich durch eine KI in die folgenden Bilder integrieren lassen. Dann brauche ich dafür keine Live-Aufnahmen und somit auch eine geringere Strahlendosis. Und die KI-Algorithmen filtern bei der Verarbeitung der Rohdaten Störungen heraus. So entstehen Bilder mit einer höheren Abbildungsschärfe. Das erfolgt live, die Daten werden online bereitgestellt, die Ärztin oder der Arzt sieht das direkt auf dem Bildschirm.
Welche Ergebnisse konnten Sie verzeichnen?
Wir hatten uns vorgenommen, dass wir die exponentielle Strahlendosis der Patient*innen um zwei Drittel senken. Dieses ambitionierte Ziel haben wir erreicht. Wir haben mit den erprobten Verfahren die gemessene Strahlung um zwei Drittel reduziert, teilweise sogar noch mehr. Wir haben so gezeigt, dass KI-Verfahren zur Dosisreduktion für interventionelle Bildgebung wirklich Sinn machen und Erfolg versprechen. Darüber hinaus haben wir auch die Reduktion von Störsignalen durch z. B. Metalle im Körper, sogenannte Artefakte, die Streustrahlenreduktion aber auch die Entwicklung von Verfahren zum Testen von KI-Methoden im klinischen Alltag vorangebracht.
Wie geht es mit den Verfahren weiter?
Wir brauchen jetzt klinische Testverfahren. Denn für die Praxis muss man das Verfahren vor Ort testen. Dafür braucht es die Zulassung vom Bundesamt für Strahlenschutz. Und wir müssen die Hersteller der Geräte überzeugen, dass sie das auch implementieren. Wir werden jetzt unsere Veröffentlichung schreiben und dann mit Firmen in Kontakt treten. Und dann in die klinische Testphase gehen. Das was wir herausgefunden haben, muss sich jetzt im Klinikalltag bewahrheiten. Aber aktuell kann man sagen: wir sind sehr weit gekommen.
Traten irgendwelche Probleme auf?
Wir wollten ursprünglich noch mehr mit echten klinischen Daten arbeiten. Das hat sich dann als schwierig herausgestellt. Wir konnten erst später als gedacht mit dem Projekt starten, da waren schon entsprechende vertragliche Regelungen zur Nutzung der Daten ausgelaufen. Das hat dann dazu geführt, dass wir viel mit simulierten Daten arbeiten mussten. Andererseits sprachen auch Datenschutzbestimmungen dagegen, Daten dann auch herauszugeben. Wenn man keine Daten hat, dass kann das so ein Projekt auch schon mal zum Scheitern bringen. Um das aufzufangen, haben wir eigene Prototypen für die Bildgebung konstruiert. Damit konnten wir immerhin die Simulation verifizieren. Um eine KI tatsächlich so zu trainieren, dass alles passt, braucht es aber mehr. Für die Übertragung in die Praxis müsste man also die Tests mit einer realen Datenbasis nachholen.
Wie vielsprechend sehen sie die Einführung in der Praxis?
Sehr vielversprechend. Die Schwelle, das Verfahren zu implementieren ist klein. Denn bei den Änderungen geht es weniger um die Hardware, sondern um die Software. Um schnelle Erfolge zu haben, reicht das aus. Finanziell dürfte sich das im Rahmen halten. Zwar muss man Schulungen mit dem Personal durchführen. Das wäre aber schon der einzige Aufwand für das Personal, der Rest läuft komplett im Hintergrund ab. Und: es geht nicht nur um den Schutz der Patient*innen, sondern auch um den Schutz des Personals, das ja mit im Raum ist. Je weniger Strahlung entsteht, desto weniger kriegen auch die ab. Da haben natürlich die Kliniken ein großes Interesse, dass das von den Firmen umgesetzt wird.